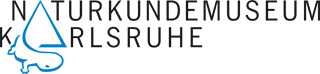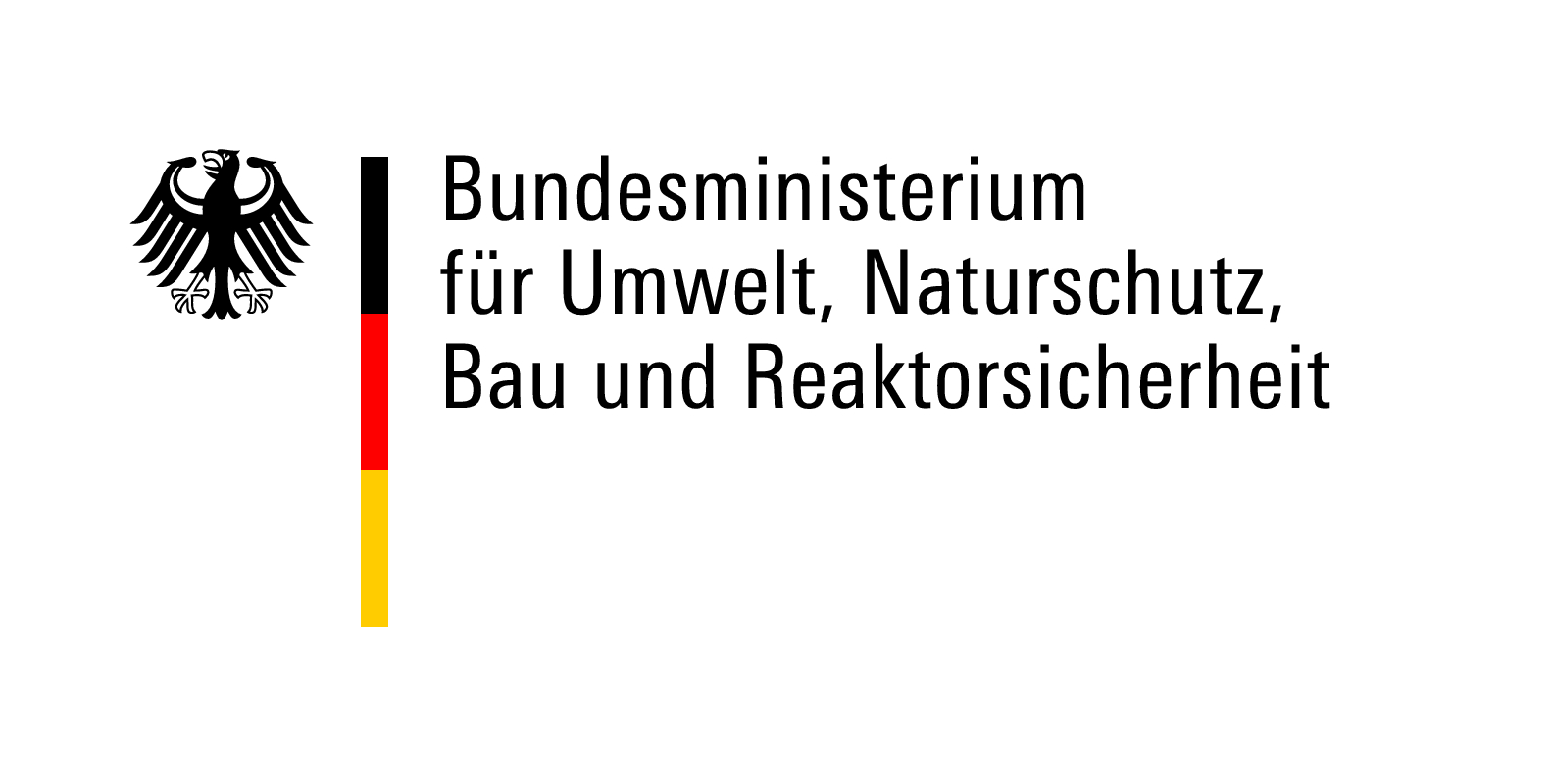Welche Maßnahmen, die auch im kürzlich erschienen „Aktionsplan für den Insektenschutz und Insektenerholung“ beschrieben sind, würden Sie als besonders dringlich bewerten? Kann das Insektensterben kurzfristig aufgehalten werden, oder bedarf es hier langfristiger Maßnahmen?
Zentral sind das Aufhalten der fortschreitenden Habitatzerstörung, die Renaturierung von degradierten Habitaten, die deutliche Reduzierung von Pestiziden und Düngern in der Landwirtschaft und eine drastische Reduzierung der täglichen Neuversiegelung. Da die Populationsdynamik von Arten immer verschiedenen Faktoren unterliegt, u.a. auch klimatischen, lässt sich nicht voraussagen, wie schnell einzelne Maßnahmen und v.a. auch wie zuverlässig sie wirken. Es müssen also mehrere Maßnahmen parallel und langfristig durchgeführt werden. Da das Insektensterben offenbar flächenhaft die gesamte Kulturlandschaft, oder zumindest große Teile betrifft, muss sich in der gesamten Landnutzung etwas ändern.
Wie gehen Forscher*innen bei einer Bestandsaufnahme von Arten vor?
Um den aktuellen Bestand zu erfassen, gibt es verschiedene standardisierte Methoden, die für die jeweiligen Insektenordnungen etabliert wurden und z.T. global angewandt werden. Für Analysen von Veränderungen ist es wichtig, dass zuverlässige historische Daten vorliegen, damit abgeschätzt werden kann, ob und wie die Populationen sich entwickelt haben. Häufig fehlen solche Daten und man kann den Rückgang nur abschätzen.
Was kann und sollte die Politik tun/ändern, um dem Insektensterben entgegenzuwirken? Was kann ich als Einzelperson tun?
Die Einzelpersonen können bereits recht viel bewegen, indem sie ihr eigenes Handeln überdenken. Gärten, Wegränder, städtische Grünflächen sollten nicht mit Pestiziden behandelt werden und ein reiches Blütenangebot aus möglichst heimischen Stauden, Sträuchern und Kräutern haben. „Ungepflegte“ Bereiche, in denen Grünland nur einmal im Spätsommer gemäht werden, bieten ein reichhaltiges Nahrungs- und Versteckangebot für eine Vielzahl von Tieren. Auch beim Einkaufen kann man darauf achten, dass die Produkte möglichst aus ökologisch nachhaltiger Produktion stammen. Die Politik müsste vor allem den landwirtschaftlichen Bereich neu strukturieren und neue Zielvorgaben formulieren, Ressourcenschonung und Artenvielfalt könnte z.B. direkt honoriert werden, im Gegenzug wären Subventionen für Produktion oder schlicht für die „normale“ Bewirtschaftung der Fläche zurückgefahren werden. Das Geld dafür ist also schon vorhanden: Übrigens: Seit Jahrzehnten führt die Landwirtschaftspolitik zum Aussterben von kleinen Betrieben und fördert vor allem die industrielle Landwirtschaft.
Wie geht es den Insekten in Deutschland? Welche Projekte gibt es hier bereits und an welchen Stellen kann man sich einsetzen?
Da in den letzten Jahren das Thema „Insektensterben“ – auf Grund des nachweisbaren drastischen Rückganges – den Weg in die allgemeine Öffentlichkeit geschafft hat, sind mehrere Projekte dazu angestoßen worden. Im Folgenden dazu einige Beispiele: